
Es gibt zwei Antworten auf die Frage „Warum schreibst du?“ Also, vermutlich gibt es hunderte und tausende – in etwa so viele, wie es Schreibende gibt, aber über diese beiden denke ich gerade nach. Eine dieser Antworten geht ungefähr so: Ich schreibe für mich selbst. Fast ausschließlich sogar. Um meine Fragen zu formulieren, um meinen Ballast auf der freien Fläche der Seiten loszuwerden und letztendlich, um mich auszudrücken. Jeder Satz, jeder Text ist ein Schritt weiter auf dem Weg, genau das zu sagen und auf die Weise zu sagen, wie ich wirklich gedacht, oder gefühlt habe. Nicht mal unbedingt, um etwas Bestimmtes mitzuteilen. Sondern als eine Art Erweiterung meiner körperlichen Existenz. Ein Buch zu schreiben z. B. schafft etwas physisch Vorhandenes von mir, das neben meiner eigenen Körperlichkeit plötzlich existiert. Parallel, aber nicht unabhängig davon. Und im Schreiben versuche ich eine Form zu finden, die meinem eigenen Selbstbild möglich nahekommt. Je näher ich dem komme, oder meine gekommen zu sein, desto befriedigender ist dieser Prozess.
Writing is like mental masturbation. A rhythmic articulation of feeling. — Allen Ginsberg
Die zweite Antwort ist eher so etwas wie: Ich möchte den Lesenden etwas mitgeben – ein Gefühl, einen Gedanken, ein Bild, in das sie eintauchen, das sie mit sich herumtragen können und in dem sie sich wiederfinden können. Sprache finden gewissermaßen, stellvertretend für die, die dasselbe erlebt, oder einmal empfunden haben, aber keine eigenen Worte dafür gefunden haben. Vielleicht sogar so etwas wie Trost, oder Hoffnung, auch wenn es vermessen klingt, so etwas zu wünschen. Den Versuch halte ich jedenfalls für wenig fruchtbar. Das lässt sich nicht künstlich produzieren, egal, wie gut wer sein Handwerk beherrscht. Kunst mit klar erkennbarer Intention ist mir meistens mehr als suspekt. Es passiert etwas, oder eben nicht. Beides ist gleichermaßen in Ordnung.
Dieser zweite Ansatz birgt die Gefahr, schon beim Schreiben diesen Filter der Erwartung eines fiktiven (oder realen) Publikums im Kopf zu haben und diesem gefallen, oder irgendwie genügen zu wollen, oder zu müssen. Die erste Antwort hingegen, könnte dazu führen, in Beliebigkeit zu zerfasern und sich selbst zu genügen und jegliche konstruktive Kritik und äußere Einflüsse auszublenden.
Es gibt aber auch noch einen dritten Ansatz. So etwas wie dem vorhandenen Kanon etwas Eigenes hinzufügen zu wollen. So vermessen das klingen mag. Vieles ist zu den meisten Sachverhalten schon gedacht und gesagt und geschrieben worden, aber eben nicht von mir und nicht heute und nicht hier. Vielleicht ist meine nicht die spannendste Perspektive, aber nun mal die einzige, die ich habe.
Schreiben als Akt der Selbstwahrnehmung und Selbstermächtigung, Selbstentleerung und Selbsterfahrung. Achtsamkeitsübung. In diesem Sinne hat das Schreiben eine schon beinahe mystische und religiöse Qualität. Obwohl man kreativen Prozessen mit derlei Zuschreibungen und Überfrachtungen sicher keinen allzu großen Gefallen tut.
Das Schreiben ist kein Genuss. Es ist das Quälende. Etwas, was man tut, wie Kotzen. Man muss es tun, obwohl man es eigentlich nicht will. – Elfriede Jelinek
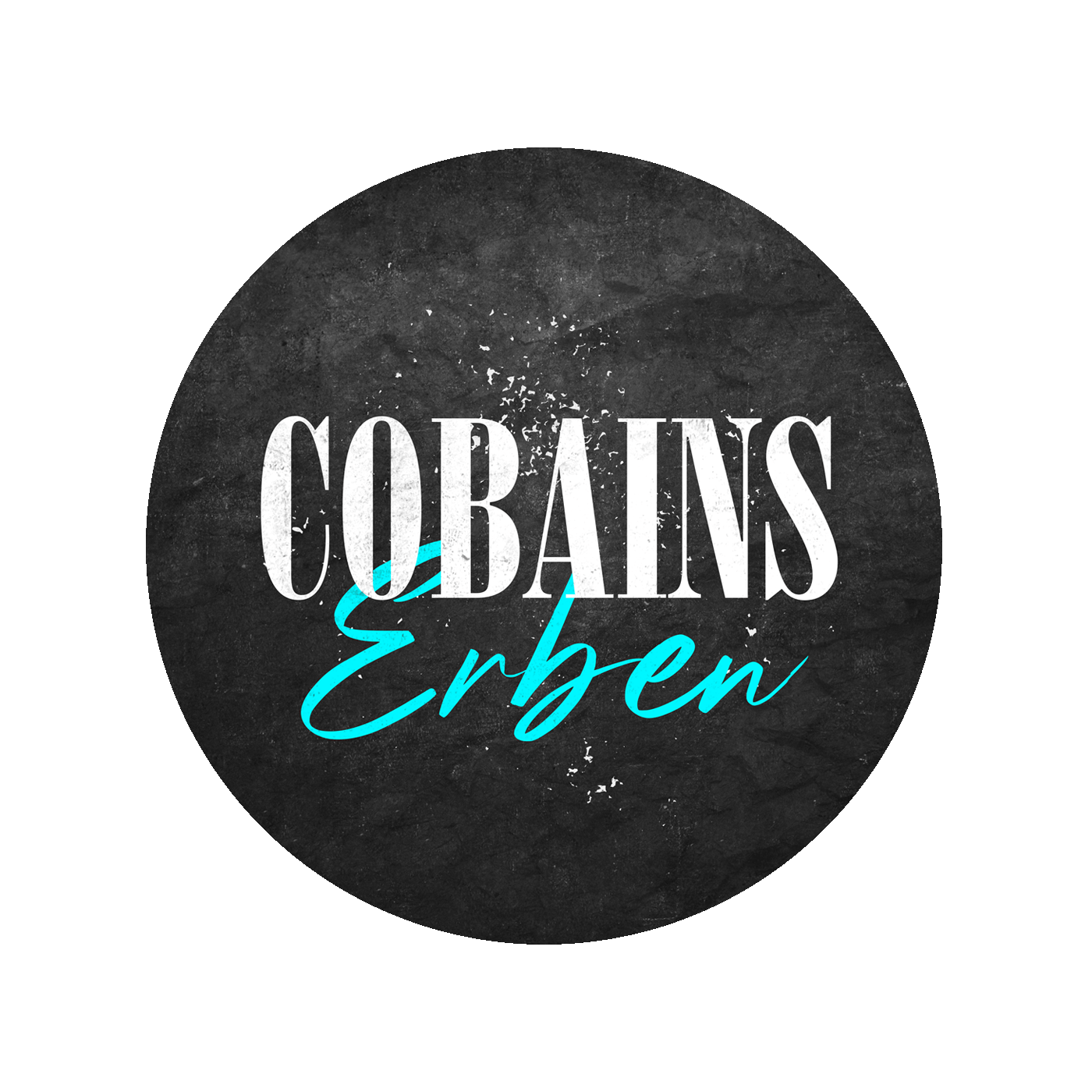
1. „Alles Kluge würde schon gedacht! Man muss nur den Mut haben, es nochmal zu tun!“ Goethe
2. Also mir macht schreiben einfach nur Spaß. Es ist das einzige im Leben, das mir leicht gefallen ist (neben einem seit eh und je gesegneten Schlaf). und das ist angesichts meines Lebens einfach nur schön. Das möchte ich dem einen oder anderen hier gerne zurufen!
Zunächst: Ein schöner Text, kurz, aber tiefgründig! (bin schon lange Hörer von dem Podcast und muss das mal loswerden, wie toll ich dieses ganze Projekt Cobains Erben finde ;-))
Zum anderen: Ich schreibe selber seit langem. Angefangen habe ich mit Gedichten, schon in meiner Grundschulzeit ging es damit los, ab der weiterführenden Schule hab ich die dann auch gesammelt und aufgehoben. Irgendwann kamen dann noch Kurzgeschichten dazu.
Um aufs Thema zurückzukommen: Ich schreibe eigentlich für mich, verarbeite meine Gefühlswelt und Erlebnisse in den Texten, färbe das lyrische Ich mal mehr, mal weniger mit meinen Erfahrungen. Und ich kann dem Zitat von Elfriede Jelinek nur beipflichten: Manchmal ist es wirklich wie kotzen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich mal mitten in der Nacht einen Text geschrieben habe, der einfach raus musste. Mein Geist und meine Gefühlswelt mussten das einfach rauskotzen. Nach einer Strophe war es nicht getan, es kamen mehrere hinzu, bis es mir wirklich besser ging.
Am Ende war es befreiend, der Weg dahin aber nicht unbedingt angenehm, die Worte zu finden für das, was da rausmusste. Der Prozess an sich war eine emotionale Achterbahnfahrt.
Letztendlich denke ich, Schreiben hat etwas von dem Prozess einer Selbsttherapie, an dessen Ende man sich selbst vielleicht ein bisschen besser versteht.
Und vielleicht gibt das Exkrement davon jemand anderem auch etwas.
Das ist vielleicht das Größte, was man als Autor erreichen kann – jemand anderen mit seinen Texten zu berühren – auch wenn es am Ende des Tages nur man selber ist.
Danke, Jules, für deinen tollen Beitrag! Das freut uns sehr, dass du das Projekt Cobains Erben feierst. Übrigens habe ich das mit dem ‚Kotzen‘ neulich beim Malen erlebt. Das geht auch. Es war ein ähnlich harter Prozess, so wie du ihn beschreibst. Aber am Ende stand ein Gefühl der Erleichterung. Liebe Grüße!