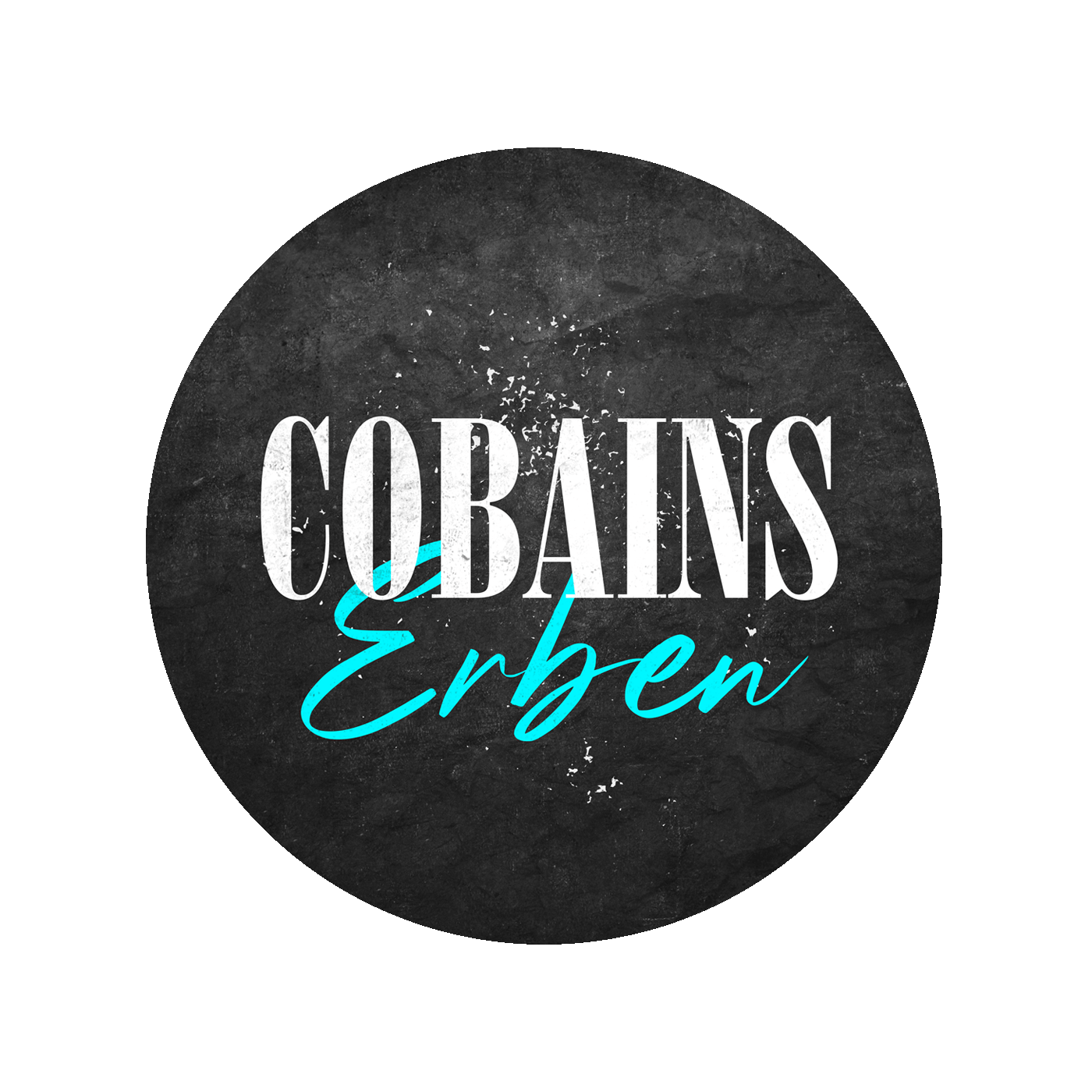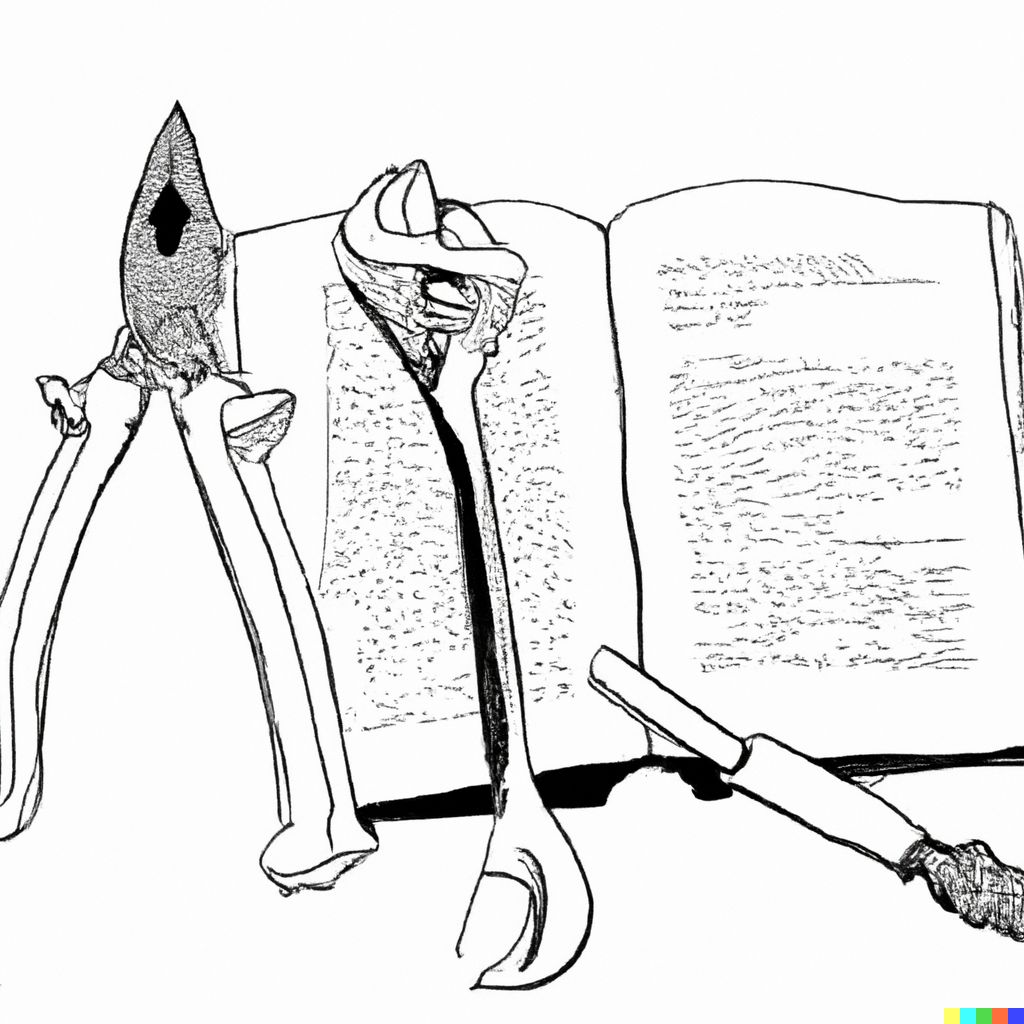
Was kann Kunst eigentlich? Was kann sie in Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen auf ihr eigenes Wohlergehen konzentrieren und das ihrer Mitmenschen ignorieren? In denen Leute zu schlichte und meistens falsche Antworten auf komplizierte Fragen hören wollen? In denen die Welt sich verändert, riesige Waldgebiete brennen, Naturschutzgebiete unwiederbringlich verloren gehen, ganze Bevölkerungen einen neuen Ort zum Leben suchen müssen, weil das Meer ihre Heimat verschlingt oder weil ein Überleben in der Hitze nicht mehr möglich ist, und es gleichzeitig Leute zur Weißglut bringt, dass sie in Zukunft nicht mehr mit dem Auto zum Bäcker fahren, ihren Swimmingpool füllen und Rechte an Menschen abtreten sollen, die eine andere Hautfarbe und eine andere Religion haben als sie, und die deshalb mit einer faschistoiden und vielleicht sogar rundheraus faschistischen Regierungspolitik keine Probleme hätten, solange die dafür sorgt, dass sie ihre Lebensgewohnheiten nicht ändern müssen?
Kann Kunst irgendwas in solchen Zeiten?
Es klingt zynisch, ist aber gar nicht so gemeint: Es macht mir Hoffnung, dass Künstler*innen in eigentlich allen Autokratien verfolgt werden. Ihre Arbeit wird als Gefahr für das Regime verstanden. Das ist gut, nicht, dass Menschen verfolgt, gefangen genommen und gefoltert werden, sondern dass Kunst als gefährlich wahrgenommen wird von jenen, die Mitmenschen verachten und für ihre Ziele über Leichen gehen. Denn das ist sie. Wenn sie gut ist.
Neulich habe ich dieses Gedicht von Bianca Stone entdeckt, das in der Zeitung THE NEW YORKER veröffentlicht worden ist. Es hat mich berührt. Deshalb habe ich es für Dich ins Deutsche übertragen. Zunächst kannst Du die originale amerikanische Version lesen, dann meine deutsche Übertragung:
“What’s Poetry Like?”
by Bianca Stone
Poets play the winter tarantella,
making love in the midnight hours
on a white iron bed like a dog skeleton
distinguishing the essential and unessential
moment, shared between ordinary lunatics
and screaming over a bird in an apple tree
until an elegy has to be written
to resuscitate the relation—those who look
toward the depleted wildlife of neighborhoods
with tragic relish, to see somehow ourselves
disappearing about ourselves.
Once, in New York City, years ago,
the Internet technician finally arrived.
His teen-age apprentice stood in my living room
over a Tranströmer book. He said it looked
kind of cool, and he wanted to know
what it was. “Poetry,” I said.
“What’s poetry like?” he asked. And
the treacherous inadequacy with which one
finds oneself explaining in a few loose
deficient words something with lungs
and no face, the immortal freak
of language you haunt and hunt
which is the original state of language
you’re trying to get back to from within—
poetry, whose rare geniuses come
as bittersweet suicidal explosions
on the tongue, randomly felt during
long, tedious meals; award-winning and
already forgotten. All the emoting of the
unanalyzable fragments. All the surrender
and detonations of precision
and reckless insight
and reference to hidden wisdom and Coke cans—
conversations across time, and slips
into truth, and obscurity of thought altogether
blissful, the form itself at its best strings of dreams
in the waking life,
overlaid like unobserved clothing:
the words that sing
stillness, the silence craved
by perpetual auctioneers—that which is not
the tale of event but itself an event—
“You know what? Just take the book,” I said finally,
pushing it into his hands—
“THANKS!” he said, and took it away, grinning a little.
But later, with snow in my head and a thunder
in my right eyelid . . . I was worried, as I was
so dangerously then, about dark, yet-unspoken things
—it frightened me: that shiny black and white book
wafting around New York City in the back
of a Time Warner Cable van, waiting to be opened,
waiting to torment him, thinking of it changing his life.
„Wie sind Gedichte eigentlich so?“
von Bianca Stone
Dichter spielen die Wintertarantella
lieben sich zu mitternächtlicher Stunde
auf einem weißen Bett aus Eisen
das aussieht wie ein Hundeskelett
trennen wesentliche von nicht wesentlichen
Momenten, die sie gemeinsam erleben wie
ganz gewöhnliche Verrückte
und übertönen schreiend einen im Apfelbaum sitzenden
Vogel, bis eine Elegie geschrieben werden muss,
um die Beziehung wiederzubeleben – jene, die
die ausgelaugte nachbarschaftliche Tierwelt
mit genüsslicher Tragik betrachten und darin
irgendwie uns selbst erkennen,
die wir um uns selbst kreisend
verschwinden.
Einmal, in New York City, schon vor Jahren
traf endlich der Internet Techniker ein.
Sein jugendlicher Lehrling stand in meinem Wohnzimmer
ein Buch von Tranströmer betrachtend. Sieht irgendwie
sagte er, cool aus. Und er wollte wissen
was es war. „Gedichte“, sagte ich.
„Wie sind Gedichte eigentlich so?“ fragte er. Und
diese trügerische Unzulänglichkeit, mit der man
plötzlich versucht, mit einigen wenigen mangelhaften
Worten etwas zu beschreiben, das zwar
Lungen, aber kein Gesicht hat, das unsterbliche
Ungetüm der Sprache, das du plagst und jagst
welches der Urzustand der Sprache ist
zu dem du aus ihr selbst heraus zurückkehren willst –
Dichtung, deren seltene geniale Momente als
selbstmörderische Explosionen auf der Zunge
zergehen, die man zufällig erlebt
während langer und langweiliger Mahlzeiten;
hochgeehrt und längst vergessen. Die ganze
Gefühlspalette unerklärlicher Bruchstücke. All die
Hingabe, die Entladung von Präzision und
rücksichtsloser Erkenntnis und die
Bezugnahme auf verborgene Weisheit und Coladosen –
Unterhaltungen über die Zeiten hinweg und Hineinstolpern
in Wahrheit und dunkle Gedanken, beglückend insgesamt
die Form selbst, die in ihren größten Momenten wie
Traumsaiten mitten im Wachzustand erklingt
angelegt wie Kleidung, die man kaum beachtet:
die Worte, die Stille singen
die Ruhe, herbeigesehnt
von ewigen Auktionatoren –
das, was nicht die Erzählung des Ereignisses ist
sondern das Ereignis selbst –
„Weißte was? Behalte es einfach“, sagte ich schließlich
während ich das Buch ihm in die Hand schob.
„DANKE!“ sagte er und nahm es entgegen
ein wenig grinsend.
Doch später, als sich Schnee in meinem Kopf
niederließ und Donner in meinem rechten Augenlid …
machte ich mir Sorgen, wie es mir damals gefährlich oft passierte,
über dunkle, noch unausgesprochene Dinge –
es ängstigte mich: dieses glänzend-schwarzweiße Buch,
das auf der Ladefläche eines Time Warner Cable Transporters
durch New York City schwirrte und darauf wartete,
geöffnet zu werden, darauf wartete, ihn zu quälen,
dieser Gedanke daran, dass es sein Leben
umkrempeln könnte.
„What’s Poetry Like?“ wurde veröffentlicht in der Printausgabe von THE NEW YORKER am 28. August 2023. Deutsche Übertragung von mir.
Gefällt es Dir auch so gut wie mir? Ich hoffe es.
Dir eine tolle Woche. Bis nächsten Montag!
Dein Gofi
Dieser Text ist ein GOFIGRAMM. An jedem Montag erscheint eine neue Ausgabe. Du kannst das GOFIGRAMM kostenlos hier abonnieren.