
Es ist wie Einzelhaft auf Alcatraz,
in Zellenblock zwei sieben.
Die Wände sind längst schwarzgemalt,
die Hände aufgerieben.
Zwischen all der dunklen Farbe
ein Hauch nur noch von weiß.
Die Jahre kommen, stehen, flehen, gehen,
drehen sich im Kreis.
Jeden Tag gibt’s grauen Einheitsbrei
in Pappschüsseln aus Blei.
Mit Steinen in die Wand geritzt
die Tage, bis die Freiheit kommt,
doch aufgehört nach zwei.
Nachts da knirschen Zähne,
Schritte hallen
in den Gängen,
bin gefallen
in die Fänge
dieser Ausweglosigkeit.
Ich schreib‘ mit stumpfen Stiften
bunte Wörter an die Wand,
erzähle still von Schwalben, Booten,
dem Geruch von Sand.
Manchmal erzähl’ ich nachts Geschichten
oder summe stumme Lieder,
doch all das, was sie im Takt berichten,
hör’n beizeiten
nur Rückseiten meiner Lider.
Aus Lachen werden Falten,
und so lang sich Hände
an Gefängnisgitter halten,
fehlen eben Hände,
um mein Leben
außerhalb
von dieser Zelle zu entfalten.
Warme Gedanken, die erkalten,
Wände bröckeln neben Betten
und an Ketten klebt der Rost
wie Parasiten und als hätten
Eisenstangen unbefangen
Blut verloren.
Ich werf’ paar Würfel in den Sand
als Zeichen meiner Unentschlossenheit.
Vergess’ die Zeit und fange dann
wieder von vorne an.
Das ist ein Hamsterrad
und ich such’ noch nach dem Ende
und ich denke
ungelenk,
wie ich es fände,
wenn meine Gelenke
die Gitterstäbe teilen.
Draußen läuft der Wachmann
beständig seine Runden.
Über mir da kreisen Möwen,
die die Freiheit laut bekunden
und ich kann nicht anders
als mich wundern,
wie ich hier gelandet bin.
Manchmal ruf ich schlaue Sätze
durch die Stäbe durch den Trakt
und hoffe, dass am and’ren Ende
irgendwer was sagt.
Doch die Antwort, die bleibt aus,
und ich frage mich, warum.
Wieso ist es in den Zellen
um mich rum so stumm?
Und im Denken und im Schweigen
und im Starren auf die Wände
fällt mein Blick schlussendlich dann auf
meine freien Hände.
Ich seh’, die Kette ist Attrappe
wie die Steine in den Hallen,
und ich sehe und ich höre,
wie zehntausend Groschen fallen.
Diese Gefängnisgitter?
Das sind meine Rippen –
und meine Ängste, die sich in mich krallen,
sind wie Klippen,
welche vor den Hallen allen
Menschen hier das Meer verweigern …
oder mir.
Sobald ich mich zum Himmel recke,
berühr’ ich meine Schädeldecke,
wie den Boden, der von Zweifeln klebt,
und eigentlich nur aus Angst besteht,
und meine Augen nur nicht glauben,
dass das alles hier
in mir geschieht.
Ich hab geschlafen, viel zu lange,
und jetzt wurde ich geweckt.
Kapiere: Ich bin nicht der Sträfling –
ich bin der Architekt.
Und so zerbiege ich die Gitter,
sprinte Treppenstufen rauf,
der Wächter sieht mich, lächelt,
nickt mir zu, und …
löst sich dann für immer auf.
Die schweren Tore sind ganz leicht,
es weht ein Wind, ich mach sie auf
und spür’, wie ich von ganz allein
im Schatten kleiner Möwen lauf’.
Unten am Steg, da ist ein Boot.
Es hat Löcher und ist alt.
Ich weiß, nicht wie man segelt,
doch das lerne ich wohl bald.
Ich schau es an, ich geh an Bord,
Alcatraz liegt hinter mir.
Dieser Ort
ist in Ruinen
und ich löse mich vom Pier.
Lichte den Anker, hisse Segel,
ich hole Luft, ich atme aus –
und fahre, wie der Wind mich trägt
aufs off’ne Meer hinaus.
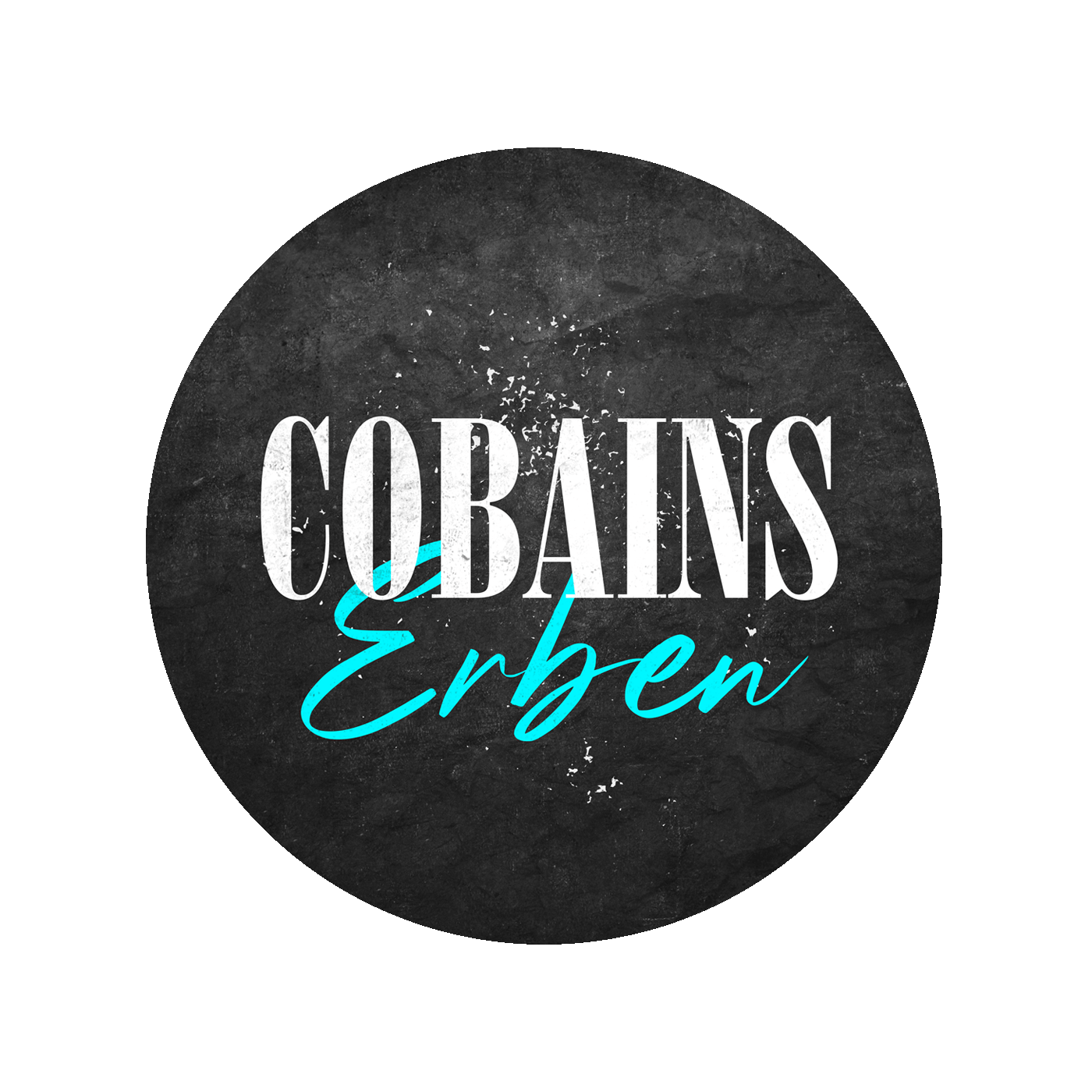
Micha…das ist sehr stark! Danke, mein Juter (und Leidensgenosse…)